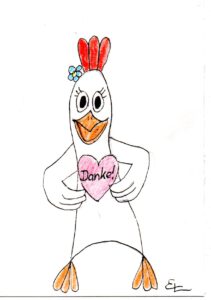Klingt eigentlich einleuchtend, oder? Ist aber nur so, weil ich seit einigen Jahren in Frührente bin und nicht mehr das halsbrecherische Tempo in der IT Branche mithalten muss. Als ich noch im Berufsleben stand, war es ganz normal jeden Tag mit Dingen konfrontiert zu werden, die man noch nicht kannte, von denen man nicht wusste ob und wofür sie zu gebrauchen waren, mit denen man sich aber umgehend beschäftigen musste, weil irgendein Chef oder höheres Gremium so entschieden hatte. Damit man einigermassen mithalten konnte, versuchten viele meiner Mitstreiter von Schulung zu Schulung zu hoppen in der Hoffnung, da wirklich über die neuesten Entwicklungen informiert zu werden. War auch ein Irrtum, die Schulungen waren meist schon veraltet ehe sie stattgefuden hatten. Da half nur eins: sich selbst schlau zu machen, Stunden um Stunden zu investieren um nicht hintendran zu fallen, Abends und am Wochenende und statt Urlaub. Das hat natürlich seinen Preis: Magenbeschwerden, Bluthochdruck, Schlafstörungen… nach ein paar Jahren in dem Wahnsinnszirkus IT: Burnout.
Und das alles nur, weil man sich nie auf erworbenem Wissen und Können ausruhen durfte, weil man nie sagen konnte: das ist mein Beruf, da kenne ich mich aus, da bin ich gut. Ich wollte ja eigentlich einen Handwerksberuf lernen, nur waren da meine Eltern dagegen, ich musste studieren. Ich war gern an der Uni, aber ausser meiner Lieblingsfremdsprache Englisch habe ich da nur sehr wenig gelernt, was mir später im Berufsleben nutzte. Einzig die Grundlagen der Programmierung halfen mir, einen guten Job zu finden und ordentlich Geld zu verdienen. Alles andere — Biologie, Chemie, Mathematik und all das war gradaus für die Katz, die mühsam erworbenen naturwissenschaftlichen Scheine interessierten in meinem Beruf niemand mehr. Und das naturwissenschaftliche Arbeiten? Hatte ich auf dem Gymnasium schon gelernt, das lag mir im Blut 🙂
Wie dem auch sei, mein Traumjob Restauratorin durfte nicht sein, aber ich habe mir die Restaurierung alter Möbel zum Hobby gemacht und schon viele schöne Stücke vor dem Sperrmüll gerettet. Ich kann stolz behaupten, ich bin eine recht gute Möbelschreinerin. Und jetzt bin ich in einem Alter, wo ich mich langsam auf den Ruhestand vorbereite, und an die jüngere Generation übergeben kann. Na ja, könnte, wenn ich Kinder oder andere Nachfolger hätte. Habe ich nicht, finde ich aber nicht schlimm weil ich eine ganz tolle Nichte und einen grossen Halunken von einem Neffen habe, die die Familientradition der erstgeborenen Rebellen fortführen 😉 Bin stolz auf die Beiden!
Ich merke aber, dass ich in letzter Zeit dazu tendiere, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen und es mal gut sein zu lassen mit dem ständigen Erlernen von Neuem. Ganz im Gegenteil, ich greife stattdessen in meinen Fundus, ins Archiv, ins Magazin, und hole Erprobtes und Bewährtes heraus, und verschaffe dem die gebührende Beachtung.
Ich habe ein grosses eBook über das Patchworkstricken geschrieben, eine Kunst die ich schon seit vielen Jahren pflege, und in der ich es zu einer gewissen Perfektion gebracht habe. Das Buch ist allerdings ein Dinosaurier, so komplizierte Sachen will niemand stricken. Jetzt schreibe ich stattdessen mehrere kleine Handarbeitsbücher über leichter erlernbare Kunststückchen auf der Strick- und Häkelnadel. Zum Beispiel die Vodoo-Bärchen, leicht nachzuarbeitende Begleiter in allen Lebenslagen, ich hab sie selbst entworfen:

Ich stehe mit einem renommierten Verlag in Verhandlungen, der sie vielleicht herausbringen möchte.
Jetzt habe ich gerade ein weiteres eBook angefangen, das “Inselfisch-Backbuch”. Warum ein Inselfisch-Backbuch? Die Rezepte stehen doch alle Online im Inselfisch-Kochbuch zur Verfügung! Ich habe aber in den letzten Jahren viele Rezepte weiterentwickelt und perfektioniert, so dass sie einfacher nachzumachen sind und sicher gelingen. Ausserdem schreibe ich gern Bücher, und es gibt auch viele neue Fotos, die Appetit machen und schön anzusehen sind.
Jedenfalls ist es ein reines Vergnügen, mir die Rezepte eins nach dem anderen aus dem Inselfisch-Kochbuch und aus dem Archiv herauszukopieren, nochmal gegenzulesen und nach Bedarf zu modernisieren. Das Buch wird der Hit zum gelingsicheren Nachbacken!
Merken sie was? In meinen Büchern geht es um die Weitergabe von Wissen und Erfahrung, und ich denke das ist gegen Ende eines abwechslungsreichen Arbeitslebens ganz normal. Wäre ich Meisterin in einem Handwerksbetrieb, hätte ich mir schon lange einen Nachfolger (oder mehrere) ausgesucht, und dem würde ich mein in langer Arbeit erworbenes Können weitergeben.
Und merken sie noch was? Ich habe nicht das Bedürfnis, meine IT-Kenntnisse weiterzugeben. Würden auch kein Schwein interessieren, weil sie schon seit Jahren veraltet sind. Na ja, nicht alle… Algorithmus ist Algorithmus, Datenbank ist Datenbank, aber die ganze “Mobile First” Propaganda ist spurlos an mir vorübergegangen. Ich kann keine App für ihr Smartphone programmieren, und damit bin ich heutzutage schon raus aus dem Rat Race.
Das ist mir aber ziemlich wuppdich, ich habe genug anderes vor, und werde sicher noch mehrere Bücher schreiben. Allerdings muss ich den langgehegten Traum, einmal meine Kinderbücher rund ums Regenbogenkistl zu veröffentlichen, leider begraben. Ich hab sie geschrieben als meine Nichte im Kindergartenalter anfing, sich für Computer zu interessieren, und meine Mama als coole Oma gefragt war, der kleinen Christina den Computer zu erklären. Die Oma und Christina waren meine dankbare Zielgruppe, wir haben toll zusammengearbeitet. Aber heutzutage sind diese Bücher hoffnungslos veraltet, ein kleiner Laptop mit Word und Excel und ein bisschen Internet lockt heutzutage keine Kinder mehr, die haben alle ihre Smartphones.
Seufz. Ich habe aber auch andere Bücher geschrieben, die nicht die schnelllebige Zeit widerspiegeln, in der sie geschrieben wurden. Da ist besonders das Büchlein “Der Inselfisch und das kleine Sterndl” zu erwähnen, in dem mein alter ego Inselfisch gut auf das kleine Kind in mir aufpasst. Es ist eine Geschichte von der Familie, und sie ist sehr zeitlos. Ich werde doch noch mal versuchen, einen Verleger dafür zu finden.
Und dann gibt es noch mein grosses Fantasy-Buch, das ich in einem bitterkalten Winter Anfang der Achtziger Jahre in meiner schlecht beheizten Studentenbude angefangen habe. Es ist eine grosse Familiensaga über drei Generationen, und spielt in einem imaginären Land zwischen den Bergen und dem Meer, in einem imaginären Mittelalter. Es beginnt an einem bitterkalten Wintertag, als eine Gruppe von Adeligen zum Jagen ausreitet… aber ich verrate noch nichts.
Das Buch hat viele hundert Seiten und ist erst vor etwa fünf Jahren fertig geworden. Na ja, schon so etwas wie ein Lebenswerk. Es gibt Intrigen, Mord und Verrat, es gibt Krieg und Feuer und edle Helden, es gibt hinreissend schöne Frauen und wahre Liebe, und es gibt Magie und Loyalität. Es gibt keine Uhren und keine Elektrizität. Mehr wird nicht verraten. Ich weiss noch nicht, ob ich es schaffe das Buch mal am Computer zu erfassen, es sind drei dicke Ordner voll handschriftlich, was vermutlich nur ich lesen kann. Aber es ist nicht veraltet, die Geschichte trägt über drei Generationen, und besonders mit dem Ende, das ich nach fast 40 Jahren gefunden habe, bin ich sehr zufrieden. Nicht schlecht für einen so alten Schmöker 🙂
Damit ist mein früher Wunsch, ich möchte mal SF&F (Science Fiction & Fantasy) Autorin werden, auch erfüllt. Ich muss noch nicht mal mein Buch neu erfinden, ich kann das nehmen was schon da ist. Mal sehen was daraus wird!