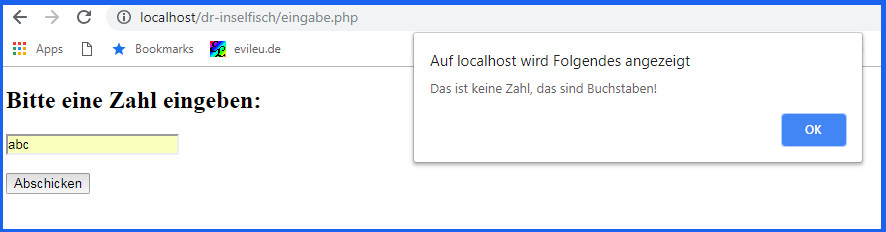Ich habe kürzlich einen sehr amüsanten und informativen Artikel von Charles Chu über vertikalen und horizontalen Reichtum gelesen:
Er leiht sich die Definition von den Unternehmensberatern und Wirtschaftswissenschaftlern, die diese Nomenklatur für die Klassifikation kommerzieller Firmen verwenden. Vertikaler Reichtum bedeutet, dass man sich an anderen reichen Leuten misst und das tut, was die auch tun: eine teure Villa einrichten, eine Yacht kaufen, in Gstaadt zum Skifahren gehen, dicke Autos fahren und in teuren Resorthotels Urlaub machen zum Beispiel.
Horizontaler Reichtum ist es, wenn man sich seine persönlichen Vorlieben nicht vom vielen Geld diktieren läßt. Sie lieben Bücher und haben einen Haufen Geld? Kaufen sie mehr Bücher und lesen sie sie mit Genuss! In dem Zuge könnte man auch die alten Ikea-Bücherregale gegen eine schöne Massivholzbibliothek austauschen.
Ich tendiere definitiv zum horizontalen Reichtum. Seit ich aus meiner zugegeben schönen, aber viel zu grossen und überteuerten Altbauwohnung in Haidhausen in mein sonniges kleines Domizil im hohen Norden von München umgezogen bin, bleibt wesentlich mehr Geld in der Haushaltskasse, weil ich nur noch ein Viertel Miete monatlich bezahle. Was mache ich mit dem ersparten Geld? Ich lasse es mir gut gehen, und bleibe dabei auf dem Teppich. Ich würde es mir dreimal überlegen, wieder in eine grössere Wohnung umzuziehen, weil die a) in München eh nicht erschwinglich sind und ich in der Stadt bleiben möchte und b) weil ich in der kleineren Bude wesentlich weniger Putzarbeit habe, und ich putze nun mal nicht so gern. Mit meiner preiswerten Miete kann ich es mir sogar leisten, fürs Fensterputzen eine Putzfrau zu bezahlen, da fällt schon mal das ungeliebteste Stück Hausputz weg, den Luxus gönne ich mir. Ausserdem ist das Schönste an meinem kleinen Domizil die grosse Fensterfront mit dem Wintergarten, und wenn da die Fenster immer sauber sind, habe ich die höchste Freude an meiner sonnigen Bude und den herrlichen Sonnenuntergängen, die ich vom Wohnzimmer aus fast das ganze Jahr lang beobachten kann. Also, ich bin mehr als zufrieden mit meiner Wohnsituation, ich mag sogar die Gegend, obwohl es eigentlich ein “Glasscherbenviertel” ist, aber ich bin hier um die Ecke aufgewachsen und kenne die schönen Platzerl im Münchner Norden.
Was gönne ich mir noch? Ein Auto, weil ich nicht immer alle schweren Einkäufe zu Fuß heimschleppen will, und weil ich gelegentlich auch mal zum Ikea oder zum Baumarkt oder zum Starberger See fahren möchte. Es ist ein recht betagter gebrauchter Kombi, aber für mich tuts der vollkommen, ich bin nicht scharf auf PS oder chromblitzende Karosserien, für mich ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand. Vielleicht tausche ich ihn mal gegen ein kleines Stadtflitzerchen um, der Kombi ist zwar praktisch, aber mir eigentlich zu gross, so ein kleiner Fiat 500 oder ein Nissan Micra würde mir auch gefallen, und ich fände viel leichter Parklücken, in die ich auch hineinkomme — einparken ist nicht meine Stärke. Ich gönne mir auch ein Motorrad, obwohl ich selber nicht mehr viel fahre, aber mein bester Freund ist ein begnadeter Motorradpilot, und ich fahre sehr gern bei ihm als Sozia mit. Mein Motorrad ist ein Oldtimer, ich hab sie schon seit fast 20 Jahren, eine alte BMW Boxer in feuerwehrrot — so eine wollte ich immer schon haben, und ich geb sie nie wieder her. Ich brauche auch kein neues Motorrad, ich habe meine Traum-Maschine schon 🙂
Schicke Designerklamotten? Aber ja doch! Ich designe seit vielen Jahren meine eigenen Strickmoden, und da sind tolle Stücke dabei, das können sie mir glauben, da krieg ich immer viele Komplimente dafür. Aber Streifzüge durch die Boutiquen mache ich nicht, da hole ich mir doch bloss einen Frust. Ich habe nämlich eine Figur, die definitiv nicht von der Stange ist. Wenn mir Hosen in der Hüfte passen, sind sie mir wegen meiner langen Haxen immer am Knöchel zu kurz, und wenn ein Blazer oder eine Bluse genug Raum für mein breites Kreuz mitbringen soll, muss ich zu Kleidergrösse Elefant greifen, und da gibts eigentlich nur Designs Marke Kartoffelsack. Also nähe ich mir meine Basics selber, da sind wenigstens die Hosen lang genug, und in den Oberteilen krieg ich meine heroischen Schultern samt der Oberweite gut unter. Also, teure Klamotten: auch Fehlanzeige.
Wo lasse ich es dann richtig krachen? Beim Essen und Trinken! Nur vom Feinsten, das Bio-Fleisch vom Dorfmetzger (bringt mir mein Freund vom Land mit), das Lamm vom Türken, das Geflügel von Stephani am Viktualienmarkt, da bin ich alle 14 Tage und nehme mir was Feines mit. Nur den besten Lavazza Espresso für meinen Frühstücks-Cafe-Latte, und abends darf es dann ein Unertl Leichtes Weizen vom Allerfeinsten sein. Besten Wein trinke ich bei meinem Freund, der kauft ihn zuhause in Württemberg direkt beim Winzer, und allerfeinste Obstschnäpse bringen wir uns aus dem Urlaub vom Walchensee mit — da reicht ein Flascherl allerdings dann allerdings schon mal ein halbes Jahr, weil wir sehr sparsam damit umgehen. Seit ich mir abgewöhnt habe, immer gleich Essen für eine halbe Kompanie einzukaufen (wir waren eine grosse Familie zuhause) komme ich mit erstaunlich wenig Lebensmitteln aus, ich esse ja meistens allein, und so darf es dann auch mal ein wenig mehr kosten.
Was ich mir sonst noch an Luxus gönne: bestes und schönstes Material für meine Hobbies. Aquarellfarben nur in allerfeinster Künstlerqualität (hab ich einen Kasten voll, halten Jahrzehnte bei gekonntem Umgang), Wolle aus überwiegend Naturfasern (bestelle ich mir Online bei einer Firma, die sehr feine Qualitäten selber produziert), feuerpolierte böhmische Glasschliffperlen zum Schmuckbasteln (bestelle ich direkt in Tschechien), erlesene Veredelungsmaterialien für meine selbstgebauten Massivholzmöbel (Schellack, Wachspolitur, Leinölfirnis… gibts in jedem Baumarkt, muss man nur verarbeiten können)… die Liste liesse sich noch fortsetzen, ich hab ja so viele Hobbies. Aber ich hab schon vor vielen Jahren gelernt, bei Selbstgemachtem nicht am falschen Ende zu sparen, und nur gutes Material einzukaufen, den Luxus leiste ich mir.
Das wars jetzt eigentlich schon so ziemlich. Gelegentlich mal ein Buch oder eine Zeitschrift (ich lese heutzutage mehr online), ab und zu ein paar Blumen, im Sommer eine Radlerhalbe im Biergarten und ein Eis beim Gelataio, im Winter ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt und ein paar Bratwürste in der Semmel oder ein Döner. Das sind die Luxusgenüsse, auf die ich nicht verzichten möchte, und die ich mir leisten kann ohne im Lotto gewonnen zu haben.
Wenn ich jetzt noch viel mehr Geld hätte — würde sich dann viel ändern? Ich würde mehr reisen, glaube ich, aber da ich nicht gern fliege fallen Luxus-Fernziele von Haus aus aus. Dann eher noch mal zum Gardasee oder ans Meer, egal ob Adria oder Nordsee, das würde ich mir sicher leisten. Aus meinem alten Kombi würde ein neues Smartle werden, und statt dem alten Dreigangfahrrad würde ich mir einen schicken Alurenner kaufen, dann würde ich sicher öfter Radfahren, zum Feldmochinger See rüber zum Beispiel. Aber ich würde mit Sicherheit nicht mein Leben auf den Kopf stellen, bloss weil ich mehr Geld hätte, da bin ich ganz zuversichtlich. Ich bin lieber horizontal reich — und eigentlich bin ich das jetzt schon 🙂